What`s wrong with prostitution?

AbolitionistInnen sehen sich mit Argumenten konfrontiert, die sich hartnäckig und leider auch sehr unreflektiert in weiten Teilen der Gesellschaft halten. Die nach wie vor am häufigsten zitierte Behauptung, Prostitution sei „das älteste Gewerbe der Welt“ beschreibt völlig unzureichend die Tragik einer Lebenssituation, die in den meisten Fällen vorherrschend sein dürfte: den Mangel an Erwerbsalternativen die eine Frau (oder einen Mann) zwingt, in letzter Konsequenz ihren/seinen Körper, oder zumindest sexuelle Handlungen, an denen der eigene Körper untrennbar beteiligt ist, zur Existenzsicherung zu verkaufen.
Dass Prostitution freiwillige Sexarbeit unter gleichberechtigten Verhandlungspartnern ist, wird immer wieder von zumeist privilegierten SexarbeiterInnen in den Vordergrund gestellt. Damit verbunden ist die Forderung, seinen Körper so einsetzen zu dürfen, wie man es selber für richtig hält. Und es ist eine selbstbewusste und klare Absage an alle, die Prostituierten pauschal einen Opferstatus verpassen wollen. In diesem Zusammenhang wird neuerdings der mit der Abtreibungsdebatte der 70er Jahre verbundene Claim „mein Körper gehört mir“ genannt, der sich ursprünglich auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Frauen, konkret das Recht auf Abtreibung bezog. Ob man diese beiden Ausgangssituationen, Abtreibungsrecht bei unerwünschter Schwangerschaft einerseits und Prostitution als Form der sexuellen Selbstbestimmung andererseits vermischen kann, ist mehr als fraglich. Freiwilligkeit in der Prostitution setzt – wie in jedem anderen Business – die Fähigkeit zu autonomem Handeln, weitestgehend existenzielle Unabhängigkeit und psychische Stabilität voraus. Die aktuelle Studie des EU-Parlaments für den FEMM Ausschuss sagt zum Begriff der Freiwilligkeit Folgendes: „Zwar wird bisweilen behauptet, dass die Zahl derjenigen, die freiwillig ins Prostitutionsgeschäft einsteigen, höher sei als angenommen, aber allgemein wird davon ausgegangen, dass Frauen den Missbrauch ihres Körpers vermeiden würden, wenn sie eine echte Alternative hätten. In diesem Sinne gelten Armut, eine schlechte wirtschaftliche Lage und schlechte Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt als schwerwiegende Faktoren, die Frauen in die Prostitution treiben und die es fraglich erscheinen lassen, ob die Einwilligung der Frauen tatsächlich als freiwillig gelten kann.“
Dass Prostitution auch heute noch in der Politik (s. Beschluss Grünen Jugend 2010) als soziales Phänomen und ernsthafte Erwerbsalternative ausgerechnet für MigrantInnen betrachtet wird, ist aus menschen- und frauenrechtlicher Sicht nicht nachvollziehbar. MigrantInnen dürften wohl zum eher schwachen Teil der VerhandlungspartnerInnen in diesem Geschäft gehören.
Der Schwerpunkt der Kritik am System Prostitution liegt, entgegen dem Verständnis einiger ProstitutionsbefürworterInnen, nicht in einer moralischen Verurteilung der selbstbestimmten Hure. (siehe dazu Heinrich Böll Stiftung) Diese tritt dem Freier nach eigener Einschätzung autonom und handlungsfähig gegenüber, bestimmt die Regeln im Geschäft und bricht das Tabu, als Frau auch für Sexarbeit – in einer Reihe mit Care- und Reproduktionsarbeit – Geld zu nehmen. In der feministischen Ökonomie ist es eine durchaus berechtigte Frage, welche Dienste, die man in den vergangenen Jahrhunderten vorwiegend Frauen, sozusagen qua reproduzierendem und sorgendem Geschlecht auferlegt hat, in bezahlte, Existenz sichernde Arbeit umgewandelt werden sollten. Entwicklungen hat es hier im letzten Jahrhundert in der Pflege- und Erziehungsarbeit gegeben. Dass diese Tätigkeiten, als traditionell typische Frauenberufe nach wie vor die am schlechtest bezahlten sind, ist ein gesellschaftliches Problem, (Stichwort: Altersarmut von Frauen) das bis heute nicht gelöst ist.
Abgesehen davon, dass Pflegekräfte und Erzieherinnen sich vermutlich aus vielerlei Gründen nicht mit Prostituierten in eine Reihe stellen lassen wollen, gibt es eklatante Unterschiede zwischen einem therapeutischen, pflegerischen oder erzieherischen Beruf und der Prostitution, auch wenn Prostituierte immer wieder den therapeutischen Charakter ihrer Tätigkeit anführen. Therapeutische Berufe haben ein klares Ausbildungsprofil, was bei der Prostitution definitiv nicht der Fall ist. Besonders dort wo es um den sensiblen Umgang mit Menschen geht, müssen umfangreiche Qualifikationen nachgewiesen werden – und das ist auch gut so. Therapeutische Distanz ist wichtig, um bei aller Empathie, die man zu einem Schutzbefohlenen oder Patienten hat, bei sich bleiben zu können. Diese Distanz kann in der Prostitution nur mit starker Abspaltung durchgehalten werden. Freier suchen die extreme körperliche manchmal sogar auch seelische Nähe, während die Prostituierte i.d.R. versucht, möglichst wenig von dem zu fühlen, was da gerade mit ihr gemacht wird. Auf Dauer führt diese Diskrepanz die im wahrsten Sinne des Wortes eine Integritätsverletzung darstellt, zu ähnlichen Symptomen wie bei einer posttraumatische Belastungsstörung. In der Therapie geht es auch immer um eine Anwendung, um eine Zuwendung, die klar definiert ist und die auch ein therapeutisches oder betreuerisches Ziel verfolgt, das letzen Endes einen Wert für die Gesellschaft darstellt: ein Mensch wird gesund gepflegt, ein Kind oder ein alter Mensch wird betreut und nicht sich selbst überlassen.
Spätestens hier stellt sich die Frage, welchen gesellschaftlichen Wert Prostitution hat. Sofort schießen einem die naheliegenden und allseits bekannten stereotyp aufgestellten Thesen dazu in den Kopf. Beliebt wie der Mythos vom ältesten Gewerbe ist z.B. „Weil damit Vergewaltigungen von anderen Frauen vermieden werden.“ Diese Behauptung impliziert zwei Dinge: zum einen würde es eine Gesellschaft damit hinnehmen, dass sich (arme) Frauen für Geld vergewaltigen lassen, um Schaden von anderen Frauen abzuwenden. Zum anderen setzt es ein Männerbild voraus, das von einem quasi staatlich verbrieften Recht auf Sex ausgeht. Beide Interpretationen entsprechen weder der Realität noch sind sie auch nur annähernd mit dem auf unserer Verfassung beruhenden Wertesystem vereinbar: dem Gleichheitsgrundsatz und der Gleichstellung der Geschlechter. Es gibt das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, aber es gibt kein Recht auf Sex. Auch nicht für Männer.
Es geht bei der Kritik an der Prostitution also weder um Moral noch um Ausgrenzung von Frauen durch Frauen, sondern alleine um die Frage, und dies sollte unter FeministInnen eher einigend als trennend sein: was sind wir bereit, mit der Akzeptanz dieses Systems für uns und wenn nicht für uns dann für andere Frauen und Männer an Verletzungen und Entwürdigungen in Kauf zu nehmen? Diese Frage wird jedoch selten gestellt. Von selbstbestimmten SexarbeiterInnen nicht, weil sie ihren Beruf weder als selbstverletzend noch entwürdigend empfinden, zumindest behaupten sie das. Und von denen, die darunter leiden nicht, weil sie in der Regel sprachlos sind. Aus eben diesen Gründen sind von den wortstarken BefürworterInnen weder Mitgefühl noch eine realistische Beurteilung der Prostitution als ein zutiefst frauenfeindliches ökonomisches System zu erwarten. Und dies, obwohl Prostitution nachweislich für die Mehrheit der Frauen geprägt ist von Sexismus, sexualisierter Gewalt und Substanzabhängigkeit.
Eine kapitalismuskritische Perspektive nimmt die Politikwissenschaftlerin Carole Pateman in ihrem Beitrag „What´s wrong with Prostitution“ (in: Philosophical Debate about the Sex Industry) ein. Sie bezeichnet Prostitution als einen integralen Bestandteil eines patriarchal geprägten Kapitalismus, der von der Annahme ausgeht, dass Männer per Vertrag das Zugriffsrecht auf den weiblichen Körper erlangen. Bildhaft wird der mysteriöse Autor von My Secret Life zitiert, in der ein Mann ein junges Mädchen fragt: „What do you men let fuck you for? Sausage Rolls?“ Sie antwortet, dass sie es auch für Meat Pie und Pastry tun würde. Eine Szene die gar nicht so weit von der Realität des heutigen, von einem harten Wettbewerb geprägten Sex-Marktes entfernt ist.
Sie beschreibt die Argumente der „Contractarians“, derjenigen, die davon ausgehen, dass ein Vertragsabschluss als politsches Mittel die Verfügungsgewalt über die Frau uneingeschränkt rechtfertigt. Eines dieser Argumente beinhaltet die Forderung, Prostitution als einen für jeden zugänglichen Markt zu deklarieren. Tatsachlich gibt es auch bei uns politische Forderungen, den Markt für alle zu öffnen und jedem die Möglichkeit zu geben, sexuelle Dienstleistungen käuflich zu erwerben. (siehe Beschluss Grüne Jugend von 2010). Ein weiteres Argument lautet, dass man Prostitution nicht einschränken oder gar verbieten dürfe, weil man damit die Menschen diskriminiere, die diesem Beruf nachgingen. Hier führt Carole Pateman ins Feld, dass niemand auf die Idee komme, Kapitalismuskritik sei gegen Arbeiter gerichtet, sondern dass es um die Kritik an ausbeuterischen Verhältnissen gehe. Beleuchtet man noch das Geschlechterverhältnis zeige sich, dass Prostitution in erster Linie ein Problem von Männern ist. Die auch von der Politik kaum widersprochene Nachfrage nach der Verfügbarkeit weiblicher Körper als einer Handelsware, einem Rohstoff, setzt ein klares Bekenntnis zum uneingeschränkten Recht des Mannes auf Sexualität voraus, das mit Unterstützung von Politik und Gesellschaft vertragsrechtlich abgesichert werden kann. Prostitution wird somit, und das ist das nächste Argument, als universelles menschliches Phänomen bezeichnet, das seine Daseinsberechtigung dem natürlichen männlichen Sexualtrieb verdanke – sofern man dies als gegeben hinnehme.
In der Prostitution nimmt die Frau dabei eine doppelt untergeordnete Stellung ein: einmal als die sexuellen Wünsche des Kunden ausführende Dienstleisterin (der Kunde ist auch hier wie in jedem anderen Gewerbe der König) und einmal als Frau, die einen Mann sexuell bedient, der sich qua Vertrag das Zugriffsrecht auf ihren Körper gesichert hat. Prostitution daher mit einem „feministischen“ Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung gleichzusetzen trifft es nicht. „Free love and prostitution are poles apart!“ Schreibt Carole Pateman. Prostitution ist demnach der Gebrauch eines weiblichen Körpers zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse. „There is no desire or satisfaction on the part of the prostitute. Prostitution is not mutual, pleasurable exchange of the use of bodies, but the unilateral use of a womans´s body in exchange for money.“ Das Prinzip der Nutzenoptimierung eines Gutes, in diesem Fall der Ware Frauenkörper, hat laut Pateman erst dazu beigetragen dass sich eine zivile patriarchale Gesellschaft entwickeln konnte. Die zivile Unterordnung von Männern und Frauen, die dem Akt der sexuellen Dienstleistung innewohnt, ist ein politisches, kein moralisches Problem.
Zum Phänomen des Abspaltungsprozesses wird Kant zitiert, der Prostitution als „pactum turpe“ bezeichnet. Damit ist gemeint, dass man in dem Momet in dem ein Körperteil für den bezahlten sexuellen Gebrauch zur Verfügung gestellt wird, dies unweigerlich die Verdinglichung der Person impliziert. Die Trennung des Menschen in ein Selbst und in eine Sache setzt voraus, dass der Mensch der Besitzer der Sache ist, die er veräußert – laut Kant so etwas wie die Quadratur des Kreises: „it is impossible to be a person and a thing, the proprietor and the property.“
Zum Weiterlesen: Prostitution and Pornography, Jessica Spector (hrsg.), Stanford University Press, 2006;
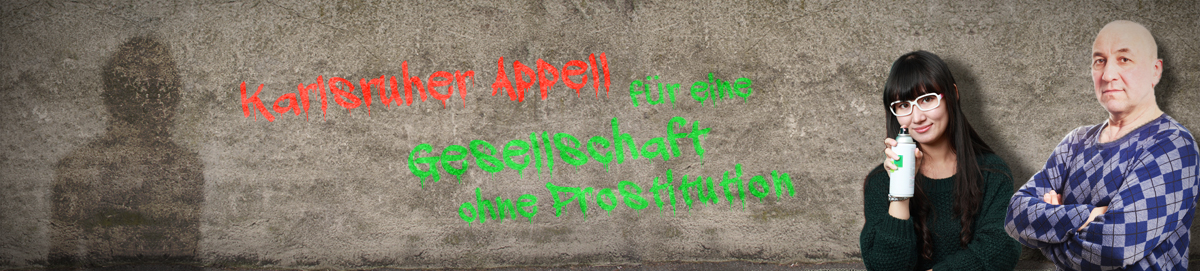
Hinterlasse einen Kommentar